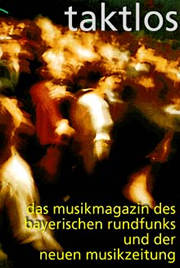 |
taktlosDas Musikmagazin des
|
|
| Musikpädagogik
und Gesellschaft Manuskript: Martin Hufner,
Regensburg, (hufner@okay.net) |
||
| Sprecher 1: Angesichts dessen, was sich seit geraumer Zeit in Europa abspielt, scheint es müßig, sich Gedanken um die Musikpädagogik zu machen. Ob man eine oder doch besser zwei Stunden Musikunterricht in der Schule haben sollte oder, ob Gruppenunterricht dem Einzelunterricht vorzuziehen sei, solcherlei Fragen wirken rein technologisch. Ja, man müßte vielmehr in Anlehnung an Theodor W. Adorno fragen: "Gibt es einen richtigen Musikunterricht im falschen Leben." Das würde viel genauer in das Zentrum des Kulturverständnisses einer sich aufgeklärt gebenden Gesellschaft zielen, als der bloß reagierende, spontane Kampf um die eine Stunde Musikunterricht. Man muß sich da nichts vormachen. Egal ob Deutsch-, Mathematik- oder Musikunterricht, im Zentrum des gegenwärtigen Erziehungs- und Ausbildungssystems steht das Ausmessen und Beurteilen von Leistungen. Diese Technik ist dem modernen Wirtschaftssystem nachgebildet, wo Begriffe wie Effektivität und Konkurrenz an der höchsten Stelle des Wertesystems stehen. Die Folge: Nur Leistungen, die sich messen lassen, sind als solche zu akzeptieren. Das ist common sense, dafür sind Lehrpläne gemacht. Was hinten runter fällt sind Eigenschaften wie Phantasie, Spontaneität und soziales Handeln, denn dafür gibt es keine Maßeinheiten. Da aber diese Fähigkeiten nicht quantifizierbar sind, spielen sie im Erziehungs- und Ausbildungsystem eine untergeordnete Rolle. Weil sich fast die gesamte Lebenskultur der westlichen Nationen auf diese quantifizierbaren Begriffe reduzieren läßt, scheint das Erziehungs- und Ausbildungssystem in der Tat adäquat. Der berühmte Satz: "Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir" bringt es auf den Punkt. Aber Vorsicht. Auf diese Weise macht man den Begriff der "Bildung von Menschen" zur reinen Vorübung für den gesellschaftlichen Status Quo. Konsequenterweise sollte man sich dann auf alle sogenannten Humanwissenschaften nur noch so weit einlassen, wie sie für eine spätere Praxis dienlich sind. Aber auch Mathematik und Physik sind in Gefahr. Denn wozu sich damit herumplagen, wenn es zahlreiche Computerprogramme gibt, die die Antworten auf lehrplanmäßige Fragen liefern. Was für ein Ameisen- oder Bienenvolk gilt, das muß längst nicht richtig sein für lebendige Menschen. Konsequent zuende gedacht führt Maß- und Regulierungssystem der Pädagogik wieder ins 19. Jahrundert zurück, und es kulminiert in der Abschaffung der Kindheit: Die Schule wird zum vorauseilenden Gehorsam auf die Ansprüche einer ökonomisch organisierten Berufswelt. Friedrich Nietzsche, Beobachter des 19. Jahrhunderts, faßte das Resultat in die knappe Beschreibung:
Sprecher 2: "Der fertig gewordene Mensch ganz abnorm. Die Fabrik herrscht. Der Mensch wird Schraube."
Sprecher 1: Gut, heute spielt der Begriff und die Funktion der Fabrik nicht mehr diese starke Rolle. Eher wird man sich wiederfinden in dem, was Jürgen Habermas die "Kolonialisierung der Lebenswelt" nennt. So wie das Wirtschaftssystem authentische Erfahrungen der Menschen kolonialisiert, so werden diese zugleich zerschunden und in einem weiteren Schritt verinnerlicht. Eine Dynamik wird in Gang gesetzt, die an den Sozialdarwinismus erinnert. Der Stärkere gewinnt das Leben. Auf diese Weise lernt man nur Anpassung, Opportunismus und Feigheit. Dieser neue "Konformismus" ist kaum reflektiert, allenfalls kommt es so zu billigen Argumenten, die sich schnell in physische Gewalt verwandeln. Plötzlich gibt es zum Beispiel Angriffe auf Asylbewerberheime. Zu sagen, es handle sich bei den Akteuren um nur irgendwie frustrierte und ängstliche Menschen, wäre zu billig. Auch der Verweis auf einen "Werte-Wandel" scheint nur bedingt als Beschreibungsmodell gültig. Die gegenwärtige Werte-Erosion ist ja kein Zufall, sondern hat ihren Grund in der gesellschaftlichen Verfaßtheit selbst: Reimer Gronemeyer und Götz Eisenberg haben in ihrer Studie "Jugend und Gewalt" darauf hingewiesen:
Sprecher 2: Seit einiger Zeit ist offenkundig, daß das Raubbauverhältnis des Kapitalismus zur äußeren Natur eine ökologische Krise von katastrophalem Ausmaß produziert hat. Aber so etwas wie eine ökologische Krise gibt es auch in bezug auf auf die innere Natur des Menschen. Die Folgekosten des herrschaftlichen und ausbeuterischen Zugriffs auf die innere Natur offenbaren sich uns nicht nur in der Zunahme von psychischen und psychosomatischen Störungen. Was wir gegenwärtig an Aggressivisierung und Brutalisierung in fast allen Lebensbereichen erleben, scheint uns ebenfalls Ausdruck der Tendenz zu sein, die Logik der industriellen Produktion und des Tausches auf Bereiche auszudehnen, die bislang Inseln gebrauchswert- und bedürfnisbezogener Zwischenmenschlichkeit gewesen sind.
Sprecher 1: Wenn es wahr ist, daß die Schule auf das Leben vorbereiten soll, so müßte man doch an erster Stelle die Frage formulieren, wie denn dieses Leben aussehen sollte. Man kann und muß sich natürlich auf die geltenden Herschaftstrukturen der Gegenwart beziehen, aber nicht so, daß man im kleinen das spätere Leben simuliert, sondern so, daß man diese Herrschaftsstrukturen an sich selbst reflektiert. Und dazu bedarf es einer anderen Logik in den Bildungszielen und im kompletten Gesellschaftsaufbau. Hierzu nochmals Eisenberg und Gronemeyer:
Sprecher 2: "Solche Bereiche, in denen eine andere Logik als die der ‘gefühllosen Barzahlung’ gelten muß, sind zum Beispiel: familiäre Beziehungen, Krankenpflege, Kinderaufzucht und Hilfstätigkeiten. Zuneigung, Zärtlichkeit, Sympathie und Einfühlung lassen sich nicht monetarisieren und in bezahlte Dienstleitungen verwandeln. ... Auch hier geht es darum, Zeit zu verlieren, nicht sie zu messen und möglichst einzusparen."
Sprecher 1: Nachdenken über Musikunterricht heißt daher nicht, sich ein feines Nest bauen, das als Asyl für die schulisch zerformten Menschen dient, quasi als Gefühlsauffanglager. Nachdenken über den Musikunterricht kann schon gar nicht heißen, den permanenten ökonomisch strukturierten Wertekatalog der Gesellschaft zum Common Sense zu erheben und es ihm gleichtun zu wollen. Sondern: Nachdenken über den Musikunterricht fängt zum Beispiel an mit dem Nachdenken über den Mathematik- und Sportunterricht. Es fängt damit an, daß man den Raum für eine Kindheit schafft, die dem Experimentieren und sich Austoben mehr als nur funktional-therapeutischen Charakter zuschreibt. Nachdenken über den Musikunterricht fängt an in den ersten Minuten eines Menschenlebens. egensburg, 4.5.1998
|