1998
|
|
1998
|
|
Feature
|
Nahe dem Möglichen wohnen Nichts und Sein Zum 75. Geburtstag des ungarischen Komponisten György Ligeti · Von Reinhard Schulz |
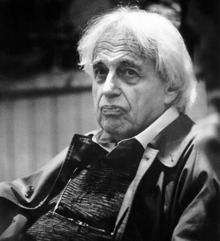 Wer einmal erlebte, wie György Ligeti in die
Problemwelten seiner Musik einführte, wird es nie vergessen. Es ist, als würde ein
Entdecker von den wichtigsten Stunden des Durchbruchs berichten. Dieser erinnert sich an
Details, die auf den ersten Blick nebensächlich waren, sich aber bald als wesentliche
Stufen herausstellten, er berichtet von der Hitze der Ahnung, auf richtiger Fährte zu
sein. Ähnlich entflammt schildert Ligeti. Und immer wieder ist er dabei ganz jung,
feurig, allen Dingen aufgeschlossen. Er, der als Sohn einer Ärztin und eines
„linksintellektuellen" Nationalökonomen zunächst Physik studieren wollte (und
auch die Aufnahmeprüfung bestand: das Studium wurde aufgrund antijüdischer Gesetze
untersagt), lebt in andauernder Wachheit gegenüber allen Phänomenen in Natur und
Gesellschaft. Wer einmal erlebte, wie György Ligeti in die
Problemwelten seiner Musik einführte, wird es nie vergessen. Es ist, als würde ein
Entdecker von den wichtigsten Stunden des Durchbruchs berichten. Dieser erinnert sich an
Details, die auf den ersten Blick nebensächlich waren, sich aber bald als wesentliche
Stufen herausstellten, er berichtet von der Hitze der Ahnung, auf richtiger Fährte zu
sein. Ähnlich entflammt schildert Ligeti. Und immer wieder ist er dabei ganz jung,
feurig, allen Dingen aufgeschlossen. Er, der als Sohn einer Ärztin und eines
„linksintellektuellen" Nationalökonomen zunächst Physik studieren wollte (und
auch die Aufnahmeprüfung bestand: das Studium wurde aufgrund antijüdischer Gesetze
untersagt), lebt in andauernder Wachheit gegenüber allen Phänomenen in Natur und
Gesellschaft. Eine kleine Liste (wo anfangen, wo enden?): Hupen als Intrada, Cartoons und Comics, Fraktale, Perspektive, afrikanische Trommelrhythmen, Escher, das Mögliche des Unmöglichen und umgekehrt, optische und akustische Täuschungen, Popart, Mikrointervalle, absurdes Theater, Vernetzungen, Computer-Mensch-Verkoppelung, Filmschnitt-Techniken, Chaostheorie, Diktatur und Anarchie, Massenbewegungen, Alice und Wunderland, Rückkoppelungen, Mechanik der Glieder, Mechanik der Maschinen, das Absurde, Minimal-Techniken, Echos, Urknall und Endzeit und das Dazwischen, das Verlöschen als Schluß. Und, und, und... Ligeti selbst ist so ein Netzwerk. Wenn er etwas erfährt, liest, sieht oder hört, dann fallen ihm unmittelbar parallele Symptome oder Erscheinungen aus ganz anderen Bereichen ein. Und nicht selten wird er mit etwas konfrontiert, das er aus anderer Warte, aus musikalischer zumeist, auch schon angedacht hatte. Als er zum ersten Mal mit den Experimenten der amerikanischen Minimal-Music eines Steve Reich in Berührung kam, registrierte er verblüfft Parallelen zu Untersuchungen, die er mit Metronomen, aber auch etwa im Cembalostück „Continuum" angestellt hatte. Und als die Speerspitze der physikalisch-mathematischen Wissenschaft mit den wundersam unendlichen Dreh- und Spiralfiguren der Fraktale die Welt in einen Taumel aus bunter Schönheit und zwingend Unfaßlichem versetzte, da ahnte er, daß diese Ungetüme der Grenzenlosigkeit sich schon längst auch in seinen Kopf, in seine Welt von Verwischungen und Überschneidungen, von Gestaltwerdung aus Ungestaltetem eingenistet hatten. Und nicht nur, weil er als (religionsloser) ungarischer Jude auf später rumänischem Territorium und nach dem Ungarnaufstand als Emigrant Grenzen schon immer als vage ansehen hatte müssen (die dreimalige Heimatlosigkeit Gustav Mahlers kommt in den Sinn). Die Begeisterung, mit der Ligeti diese Verknüpfungen in bezug auf sein musikalisches Wollen erläutert, entstammt der Besessenheit, mit der er wie ein Forscher, der Dingen auf der Spur ist, eine Idee verfolgt. Welche? Das ist nicht trivial zu beantworten. Sie wird, sie muß trotz eines sich rundenden Lebenswerks wie alles Menschliche Stückwerk bleiben. Dennoch aber wird sie vom Werk eingekreist und abgesteckt. „... but –, There was a long pause. ‚Is that all?‘ Alice timidly asked. ‚That’s all,‘ said Humpty Dumpty. ‚Good bye‘." Diese Worte aus Lewis Carrolls „Alice im Wunderland" stehen am Ende von Ligetis zehn Stücken für Bläserquintett. Sie stehen über seiner ganzen Arbeit. „Das ist alles", sagt das Stückwerk und weiß um die Doppeldeutigkeit von „Mehr haben wir nicht" und „Hiermit ist alles gesagt". Auch diese Worte also geben den Prozeß frei zu einem fraktalen Unendlichkeitsmuster. Gehen wir diesem Gedanken nach. Über sein 1963 bis 1965 geschriebenes Requiem merkte Ligeti einmal an, daß er bei der Komposition alle davor liegenden Requiem-Kompositionen im Ohr aufgehoben hatte. Der Klang ist ein summum der Geschichte, ihr Desiderat, ihre Essenz. Gleichzeitig ist er ein genuin neuer. Wenn nun einer käme, um in derselben Absicht ein Requiem zu schreiben, dann hätte er – und das kommt fraktalen Prozessen selbstähnlich nahe – wiederum die Geschichte zusammenzubinden, wobei das Requiem Ligetis nunmehr ein weiterer Bestandteil von ihr wäre. Wieder würde er aufnehmen und sein Neues dem Alten akklimatisieren. Im Grunde aber ist dies ein Gesetz, das alle musikhistorischen Prozesse, ob eingestanden oder nicht, bestimmt. Es ist der Grenzgang des immer gleichen und immer anderen Ausdrucks, seine Tastzonen berühren keine neuen Räume, aber erforschen in ihnen Bereiche innerer Unendlichkeit. Hier gräbt Ligeti. Sein Interesse an Naturvorgängen, an gesellschaftlichen Prozessen aber ist keines, das nur einem wissenschaftlichen Drang genügt. Mit Mechanik der Finger in bezug auf die Tasten, was als Initialreiz den Etüden zugrundeliegt, kann man zwar gewisse technische Prozeduren beschreiben, man kommt den Stücken selbst aber kaum näher. Denn immer vernetzt Ligeti diese mechanischen, physikalisch-technischen Prozesse –und in unterschiedlichen, jeweils gegenstandsbezogenen Formen bilden sie die Basis in fast jedem seiner Werke – mit existentiellen Bestimmungen des Menschen. Denn der ist nicht losgelöst davon, sondern darin eingespannt wie in ein beständig fluktuierendes Datennetz. Wahrnehmung und Täuschung, das Kippen der Raster (ein 50stimmiger Kanon etwa wird nicht als solcher erkannt, sondern zur phosphoreszierende Fläche gebündelt), all dies sind Bestimmungen, die das Dasein, das Verhältnis vom Ich zur Welt, prägen. Die Werke spiegeln die Komplexität – und was kommt nicht alles zusammen an historischen Konnotationen, gesellschaftlichen Befrachtungen und wahrnehmungspsychologischen Verschiebungen –, zugleich stehen sie, subjektiven Individuen gleich, ratlos und ratsuchend, alleingelassen und zugleich daseinsfroh in der Welt. Es waren im Grunde immer schon zwei Pole, von denen aus Ligeti in die Tiefe vorzudringen suchte. Der eine ist der Pol der Verwischung, der Verschleierung. Linien überlagern sich zum nicht mehr durchhörbaren Geflecht, Klänge kommen aus weiten Fernen, aus undefinierbaren Stillezonen, selbst an der Kippe der Unhör-barkeit. Tiefen und Höhen dringen in unauslotbare Regionen vor, Rhythmen und Metren verschränken sich in die Unabzählbarkeit, zum diffusen Dauerimpuls. Hierher gehören „Apparitions" (1958/59), „Atmosphères" (1961), „Volumina" (1961/62), Teile des Requiems, „Lux aeterna" (1966), „Lontano" (1967) oder auch „Continuum" (1968) – um einige zu nennen. Der zweite Pol aber ist der des grellen Lichts, der heftigen Geste, der Überzeichnung. Absurde Momente, in sich gebrochen, provozierend klar bestimmen das Bild wie eine rätselhafte Karikatur. Das elektronische Stück „Artikulation" (1958), die semitheatralen „Aventures" (1962) und „Nouvelles Aventures" (1962/65), die Agitato-Teile des Requiems, die „Zehn Stücke für Bläserquintett" (1968), schließlich auch, freilich umfassender gedacht, die Oper „Le Grand Macabre" (1974-77) haben in diesem Ansatz ihre Wurzeln. Gleichwohl zielen beide Pole in eine Richtung, hin auf die schon oben benannte „Idee", in der schöpferisches Tun heute zusammenläuft. Und es gibt Arbeiten, in denen auf einmal etwas ganz Neues uns entgegenleuchtet. Nicht ein kurz bestrichener Seitengang (auch die gab es, virtuos etwa in den Cembalostücken „Hungarian Rock" und „Passacaglia ungherese"), sondern so etwas wie das Zusammendenken der Pole. Dabei entstehen nicht eine Überlagerung oder ein Abwechseln der Elemente, sondern, wie auch in der Natur, ein Funke. Momente des Mysteriösen dringen an die Musik, das Ohr lauscht an Geheimnisvollen. Wo ist das zum ersten Mal deutlich spürbar? Vielleicht schon im raunend tiefen Beginn des Requiems, gewiß aber dann im Horntrio aus dem Jahr 1982. Jahre weitgehenden Schweigens – wohl auch der Ratlosigkeit des Komponisten angesichts aufweichender ästhetischer Prämissen im Zeichen der Postmoderne geschuldet – gingen ihm voraus. Und plötzlich, als Funke, im Moment des Berührens von universaler und menschlicher Hand, entsteht eine neue Welt. Nicht eine, die Lösungsvorschläge anbietet oder Dinge zu erklären weiß: Es ist eine, die tiefere Rätsel stellt und sich über sie des Rätselcharakters unseres Daseins inne wird. Was ist das, das da Beethovens „Les adieux" zitiert, an Brahms’ Horntrio denkt , die Töne und Intervalle wie bei Webern vereinzelt und intensiviert, über die ganze Musikgeschichte einen Bogen spannt und dennoch gleich einem einsamen, unbekannten Relikt einer unerklärlichen Kultur durchs All treibt? – wie eine Flaschenpost ohne Ziel, da ihr Empfänger die Botschaft nicht zu dechiffrieren weiß. Ganz so nämlich verwittert die Musik in der desolaten Passacaglia des Schlußsatzes, wo vorangegangene thematische Materialien aufgegriffen werden, ohne sie einer Heimat entgegenzuführen. Am Schluß nur noch Pedaltöne des Horns pfeifend Ätherisches in der Violine und Bruchstücke von „Les adi-eux". Das Horntrio, hat man es einmal wahrgenommen und nicht nur gehört, ist ein Werk, das einen nicht mehr los läßt – was nur ein anderes, vielleicht besseres Wort für ergreifend ist. Der Ton kehrt wieder: in anderen Brechungen. Vielleicht in der sechsten der Klavieretüden mit dem Titel „Automne à Varsovie" (Herbst in Warschau, Warschauer Herbst), zwingender noch im Klavierkonzert (1985-88) oder im so merkwürdig fremde Land-schaften durchstreifenden Violinkonzert (1990/92). Okarinas und Lotusflöten dringen da wie schaurig sanft heulende Gespensterstimmen in abgeklärten Gesang, der schön ist wie selten bei Ligeti. Keine Angst gibt es mehr vor solchen Schönheiten, die von der Avantgarde der 50er und 60er gemieden wurden wie die Sirenen von den Schiffern. Ligeti kann die (geschichtlich berechtigte) Scheu davor ablegen, weil er hier in tiefere Gewässer, zu anderen Ängsten vorgedrungen ist. Sie beziehen sich auf nichts weniger, als auf unsere Existenz. So stellt sich Werk für Werk etwas mehr davon ein, was die oben angesprochene schöpferische Idee sein könnte. Sie ist, auch oder besser gerade der Komponist ist davon nicht freigesprochen, ein Tastgang ins Ungewisse zwischen Nichts und Sein. Und die Arbeiten geben davon kund. Sie gleichen Nachrichten, die ein Höhlenforscher an die Oberfläche schickt. Dort berichten sie von einer Welt, die uns unbekannt ist, die wir nicht begreifen, von der wir uns aber über sie eine Ahnung bilden können. „That’s all", said Humpty Dumpty. |
| Links |
@ leserbrief @ nmz info (internetdienste) und hilfe |
||
|
@ KIZ, das Kultur-Informations-Zentrum der nmz |
@ aktuelle ausgabe |
@ anzeigenpreise
print |
|
| Home |
© copyright 1997 ff. by |
Postanschrift |
|